
• Lebenslauf • Schriftenverzeichnis •Blog • Impressum • Home
 |
• Lebenslauf • Schriftenverzeichnis •Blog • Impressum • Home |
||
| Deutsch | English | Español |
2. Auflage 2010 (Dezember
ISBN 978-3-8305-1865-5
3. überarbeitete Auflage 2012 (Mai)
ISBN 978-3-8305-3077-0
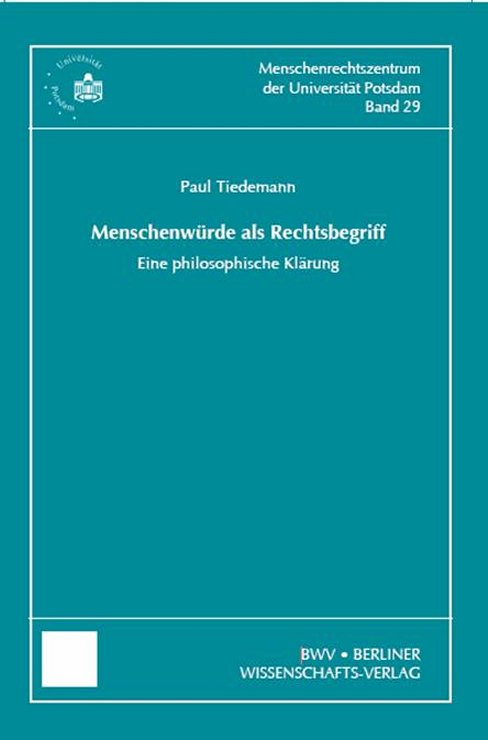
Mit diesem Werk lege ich die wesentlichen Ergebnisse einer ca. 14jährigen Forschungsarbeit über den philosophischen und rechtlichen Begriff der Menschenwürde vor. Ziel des Buches ist es, zu einem verantwortlichen Umgang mit der "Großvokabel" Menschenwürde beizutragen Es wird gezeigt, dass der Begriff ursprünglich ein philosophischer ist. Er hat eine sehr distinkte philosophische Bedeutung. Das steht im Gegensatz zu der sehr ungenauen Verwendung im politischen, ethischen und juristischen Bereich. Es wird aufgezeigt, warum die Menschenwürde richtigerweise als absoluter Höchstwert betrachtet werden muss. Der Anwendungsbereich dieses Wertes mag klein sein, sein Gewicht ist dafür um so größer.
Da der Begriff der Menschenwürde ein philosophischer Begriff ist, kann er nicht ohne eine philosophische Analyse seines Gehalts geklärt werden. Deshalb befassen sich 15 Kapitel mit dem Thema unter philosophischen Gesichtspunkten, während zwei Kapitel der Rechtsgeschichte und eines der Rechtstheorie gewidmet sind.
Jedem Kapitel ist eine Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache vorangestellt. Eine sehr umfangreiche Bibliographie und ein umfangreiches Verzeichnis der einschlägigen nationalen und internationalen Rechtsprechung vervollständigen das Werk. Nachfolgend finden Sie die Zusammenfassungen zu den einzelnen Kapiteln
Der Begriff der Menschenwürde gehört seit der Gründung der Vereinten Nationen zum Begriffsbestand des humanitären Völkerrechts. Das UN Recht versteht die Menschenwürde als einen vorrechtlichen universalen Wert, den alle Völker anerkennen. Es wurde jedoch bisher bewusst ver-mieden, den Inhalt des Begriffs philosophisch aufzuklären. Seit den Inter-nationalen Menschenrechtspakten von 1966 enthalten zahlreiche Doku-mente die Formulierung, dass die Menschenrechte aus der Menschenwür-de abgeleitet werden können.
Die Menschenwürde hat unter dem Einfluss des UN-Rechts auch Eingang in das Recht regionaler internationaler Abkommen und zahlreicher nationa-ler Verfassungen gefunden. Dabei wurde die Grundidee des UN-Rechts jedoch häufig nicht angemessen rezipiert.
Trotz eines über 60 Jahre andauernden insbesondere in Deutschland sehr inten-siv geführten juristischen Diskurses über Menschenwürde besteht bis heute keine allgemeine Übereinstimmung über den Bedeutungsgehalt des Begriffs. Vor allem der Dissens zwischen einem heteronomischen und einem autonomischen Ver-ständnis von Menschenwürde steht im Vordergrund. Der Dissens beruht auf der Weigerung der Juristen, sich mit philosophischen und rationalen Methoden dem Begriff zu nähern.
Die Würde des Menschen beruht nach dem heteronomischen Konzept auf der Wahl des moralisch guten Lebens. Wer eine andere Wahl trifft, verfehlt den Sinn seines Lebens und damit auch seine Würde als Mensch. Dieser Begriff von Men-schenwürde geht auf die griechisch/römische Stoa zurück und wurde sowohl vom Christentum als auch in dem neuzeitlich rationalistischen Naturrecht übernommen. Er findet sich aber auch im Konfuzianismus.
Das autonomische Konzept sieht die Würde des Menschen in seiner Willensfrei-heit, also darin, nicht wie die Tiere durch Triebe determiniert zu sein, sondern frei sein Leben selbst gestalten zu können und jederzeit in der Lage zu sein, "seine Sünden zu bereuen" und sein Leben grundlegend zu ändern. Dieses Konzept ist eine Entdeckung der europäischen Renaissance. Es gibt dazu keine Parallele in anderen Kulturen.
Die Entwicklung einer Theorie der Menschenwürde muss auf Methoden beruhen, die universal gültig sind. Universale Gültigkeit bedeutet, dass prinzipiell jeder Mensch unabhängig von seinem kulturellen Hintergrund in der Lage sein muss, die Methode nachzuvollziehen. Die Methode der Argumentation ist universal gültig. Sie darf aber nur mit formal-logischen, transzendentalen, sprachanalyti-schen, phänomenologischen, empirischen und evaluativen Argumenten geführt werden.
Menschenwürde ist der Name für das Werturteil: "Dem Menschen kommt ein abso-luter Wert zu." Werte sind subjektive Maßstäbe, an Hand deren wir entscheiden, welche Gegenstände wir anderen Gegenständen vorziehen. Ein absoluter Wert ist absolut bindend, d.h. es ist nicht möglich, Bewertungen ohne Rücksicht auf diesen Maßstab vorzunehmen. Aus dem Begriff der Würde (absoluter Wert) lässt sich nichts für die Frage nach dem Kriterium dieses Wertmaßstabs ableiten.
Der freie Wille ist für jede Person ein absoluter Wert, weil über die Willensfreiheit Authentizität und Identität erfahren wird. Bedingung der Möglichkeit, Authentizität zu erfahren, ist die Anerkennung des Individuums als Person durch andere Perso-nen. Das Individuum kann die Haltung der Anerkennung nur dann übernehmen, wenn es realisiert, dass die Anderen selbst Personen sind. Die absolute Wert-schätzung der eigenen Personalität ist somit gleichursprünglich mit der absoluten Wertschätzung der fremden Personalität. Deshalb ist Menschenwürde ein kollekti-ver absoluter Wert.
In diesem Kapitel wird zunächst geprüft, ob die im 6. und 7. Kapitel entwickelte Argumentation mit den methodischen Überlegungen vereinbar ist, die im 5. Kapitel angestellt worden sind. Sodann werden mögliche Einwände gegen die Argumenta-tion diskutiert. Es wird gezeigt, dass alle diese Einwände nicht stichhaltig sind.
Ein menschenwürdiges Leben ist nicht möglich in Situationen, in denen die Freiheit des Willens einer Person eingeschränkt oder vernichtet wird oder die konkrete Gefahr einer solchen Einschränkung oder Vernichtung besteht. Die Abwesenheit dieser Situationen (Freiheiten) lassen sich als Achtungsbereiche der Menschenwürde beschreiben. Zu diesen Achtungsbereichen gehört die leibseelische Integrität. Sie wird bedroht durch Folter und andere Beeinträchtigungen des Leibes und der Seele, die ähnliche Folgen haben.
Zu den Achtungsbereichen der Menschenwürde gehört auch die geistige Integrität. Sie ist gewährleistet, wo Vertrauen sowie die Freiheit der Kommunikation, die inne-re Ehre, die Freiheit des Gewissens und das geistige Existenzminimum geachtet werden. Ob auch die Freiheit der religiösen Praxis einen Achtungsbereich der Menschenwürde darstellt, wird diskutiert.
Zu den Achtungsbereichen der Menschenwürde gehört auch die Privatsphäre. Sie umfasst in örtlicher Hinsicht die Privatwohnung, die gegen öffentliche Beobachtung und Kontrolle vollständig geschützt sein muss. Sie umfasst ferner den Schutz von Tagebüchern, intimer zwischenmenschlicher Beziehungen, vertraulicher höchst-persönlicher Kommunikationen und die Kontrolle aller personenbezogenen Daten des Betroffenen.
Die schiere Existenz (das Leben) der Person ist ein Achtungsbereich der Men-schenwürde, obwohl es möglich ist, eine Person zu töten, ohne dabei ihre Men-schenwürde zu verletzen. Wer glaubt, ein Verfügungsrecht über fremdes persona-les Leben zu haben, untergräbt damit den Sinn für seine eigene Würde und die Würde aller anderen Personen.
In zahlreichen juristischen und ethischen Diskursen der Gegenwart spielt das Ar-gument der Menschenwürde eine maßgebliche Rolle, obwohl es hierfür keine Rechtfertigung gibt. Dies wird an einigen Beispielen gezeigt, nämlich an der Recht-fertigung des Schutzes öffentlicher Selbstdarstellung, der Rechtfertigung des Dis-kriminierungsverbotes, der Kritik an "Demütigung", der Rechtfertigung von Privateigentum und einem "Recht auf Arbeit", der Rechtfertigung und der Kritik an den Zwecken und Prinzipien der Kriminalstrafe, an der Kritik der Gentechnologie sowie der Rechtfertigung "kollektiver Menschenrechte" und eines postmortalen Persönlichkeitsschutzes.
Wenn die Menschenwürde mit anderen Werten (z.B. Freiheit, Gleichheit, staatliche Souveränität) konfligiert, ist stets der Menschenwürde der Vorzug zu geben. Wert-konflikte zwischen Menschenwürde und Menschenwürde können in manchen Fäl-len mittels der Kriterien der moralischen Unfähigkeit, der Freiwilligkeit oder der Unterscheidung zwischen anthropogenen und schicksalhaften menschenunwürdi-gen Zuständen aufgelöst werden. Es gibt jedoch "Würde gegen Würde" - Konflikte, die nicht auflösbar sind (Dilemmata). Zwei Hilfsregeln für diese Fälle werden disku-tiert. Gemäß der absoluten Präferenz der Menschenwürde sind Hilfeleistungen für Menschen in Not bis zur Grenze des eigenen menschenwürdigen Existenzmini-mums zumutbar.
Menschenwürde als absolute subjektive Präferenz ist eine Volition zweiter Ord-nung. Sie kann in Konflikt geraten mit unseren Volitionen erster Ordnung. In einem solchen Konflikt erfahren wir unsere Achtung der Menschenwürde als Pflicht. Um die Befolgung dieser Menschenpflichten sicherzustellen verleihen Personen einander Menschenrechte.
Die Menschenwürde ist eine Bedingung der Möglichkeit einer jeden Rechtsord-nung. Das impliziert weder die Pflicht des Staates zum Schutz der Menschenwür-de, noch eine Rechtspflicht zur Wahrung der Menschenwürde für jedermann. Die Menschenwürde ist das Fundierungsprinzip der Grundrechte, sofern diesen ein Menschenrechtsgehalt zukommt. Das Prinzip der Menschenwürde hat Konse-quenzen für die Anerkennung von Rechtssubjektivität. Die internationalen Men-schenrechtskonventionen bieten zusätzliche Kontrollmechanismen zur Wahrung der Menschenwürde.
Die meisten Verfassungen deklarieren neben der Menschenwürde noch andere Grundwerte. Das Verhältnis zwischen der Menschenwürde und diesen Grundwer-ten wird exemplarisch am Grundwertekatalog der Europäischen Union geklärt, der neben der Menschenwürde und den Menschenrechten die Grundwerte der Frei-heit, Gleichheit, Demokratie und Rechtstaatlichkeit umfasst. Freiheit meint Hand-lungsfreiheit und fordert die Rechtfertigung von Beschränkungen. Gleichheit meint Gleichbehandlung bei der Zuteilung von Beiträgen und Gewinnen einer Kooperati-on. Sie fordert die Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen. Die Menschenwürde ist diesen Werten übergeordnet. Demokratie ist ein Mechanismus zur Koppelung der politischen Herrschaft an die öffentliche Meinung. Die Menschenwürde gehört zu ihren Existenzbedingungen. Rechtsstaatlichkeit ist ein Instrument zum staatli-chen Schutz der Menschenwürde, der Freiheit und der Gleichheit.
Nichtpersonalen Lebewesen kommt keine Würde zu, weil Personen sich über nichtpersonale Lebewesen nicht als authentische Personen identifizieren können. Nichtpersonale Lebewesen haben deshalb für Personen keinen absoluten Wert. Der Ausdruck "Würde der Kreatur" führt zu einer unnötigen Konfusion und sollte vermieden werden.